

Kennen Sie das? Sie haben ein Team aus hochqualifizierten, engagierten Fachleuten zusammengestellt, aber die Ergebnisse bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Projekte verzögern sich, die Stimmung im wöchentlichen Meeting ist merklich angespannt und dieselben zermürbenden Konflikte flammen immer wieder auf. Der menschliche Reflex ist sofort zur Stelle: „Herr Meier bremst mal wieder alles aus“, „Frau Schmidt ist einfach zu negativ“ oder „Das neue agile Team liefert endlose Diskussionen statt Resultate.“
Dieser Impuls, den Fehler bei einzelnen Persönlichkeiten zu suchen, ist verständlich und tief in uns verankert. Doch was, wenn wir das Problem am völlig falschen Ende anpacken? Was, wenn nicht der einzelne Mitarbeiter das Problem ist, sondern das System, in dem er agieren muss? Ein System mit unsichtbaren Regeln, unklaren Verantwortlichkeiten und verborgenen Machtstrukturen, das selbst die besten Absichten sabotiert.
Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine strategische Reise zu den unsichtbaren Kräften, die das Verhalten in jeder Organisation steuern. Wir beginnen bei den sichtbaren Symptomen des Alltags, tauchen ein in die gefühlte Realität der Beteiligten und decken schließlich die mächtigen Tiefenstrukturen auf, die über Erfolg oder Scheitern von Zusammenarbeit entscheiden. Am Ende halten Sie ein klares Framework in den Händen, um nicht länger an Menschen zu reparieren, sondern wirksame Systeme zu gestalten.
Das sichtbare Chaos: Wenn gute Teams an sich selbst scheitern
Der Organisationssoziologe Stefan Kühl liefert in seinem aufrüttelnden Buch „Wenn die Affen den Zoo regieren“ eine brillante Diagnose für ein Phänomen, das in der modernen Arbeitswelt grassiert: der blinde Enthusiasmus für flache Hierarchien. Die gut gemeinte Abschaffung formaler Strukturen führt oft nicht zu mehr Freiheit und Agilität, sondern zu toxischen, informellen Mustern, die Effizienz und Moral untergraben.
Wenn Ihr selbstorganisiertes Team also nicht vorankommt, lohnt sich ein genauer Blick auf drei typische Pathologien, die in solchen Umgebungen gedeihen.
Pathologie 1: Der „Silberrücken-Effekt“

Wo formale Führung fehlt, entsteht ein Machtvakuum. Dieses Vakuum bleibt selten leer. Es wird unweigerlich von informellen Anführern gefüllt – oft den dominantesten, redegewandtesten oder am längsten dienenden Personen im Raum. Diese „Silberrücken“ treffen Entscheidungen ohne offizielle Legitimation und ohne Rechenschaftspflicht. Das Problem: Kritik an ihren Entscheidungen wird sofort persönlich, nicht sachlich, denn ihre Machtposition existiert ja offiziell gar nicht. Das Team wird zur Bühne für subtile Machtkämpfe statt zur Werkstatt für Innovation.
Pathologie 2: Die Tyrannei der Strukturlosigkeit

Aus der puren Angst, hierarchisch oder autoritär zu wirken, wird der Versuch unternommen, alles im Konsens zu entscheiden. Die Folge ist eine lähmende Endlosschleife aus Meetings, emotionaler Erschöpfung und komplettem Entscheidungsstillstand. In diesem Klima gewinnt nicht die beste Idee, sondern derjenige mit dem längsten Atem oder der höchsten Frustrationstoleranz. Der Zwang zur Harmonie unterdrückt gesunden, konstruktiven Streit und erstickt jede Form von Effizienz. Wie die amerikanische Feministin Jo Freeman schon 1972 feststellte, ist „Strukturlosigkeit“ oft nur eine Maske für undurchsichtige und unkontrollierte Macht.
Pathologie 3: Die organisierte Unverantwortlichkeit

Wenn Verantwortung diffus im „Team“ oder im „Kollektiv“ schwebt, fühlt sich am Ende niemand mehr wirklich zuständig. Wichtige, aber vielleicht unangenehme Aufgaben bleiben konsequent liegen. Auf Nachfrage kann man sich immer auf das Kollektiv berufen – eine perfekte Ausrede für das individuelle Nicht-Handeln. Das Ergebnis ist ein System, in dem alle beschäftigt sind, aber niemand wirklich Verantwortung für das Endergebnis übernimmt.

Der erste Schritt zur Lösung liegt also nicht darin, die endlosen Diskussionen besser zu moderieren oder Team-Building-Events zu veranstalten. Der Schlüssel liegt darin, die informellen, dysfunktionalen Strukturen sichtbar zu machen und sie durch intelligente, transparente und legitimierte Regeln zu ersetzen. Es geht nicht um starre Bürokratie, sondern um einen klaren Rahmen, der echte Selbstorganisation erst ermöglicht.

Die menschliche Erfahrung: Wie sich das System wirklich anfühlt
Die pathologischen Muster sind nun benannt. Aber wie fühlen sie sich für die Menschen auf den verschiedenen Positionen im Unternehmen an? Um das zu verstehen, müssen wir eine Empathie-Brücke bauen. Der renommierte Systemforscher Barry Oshry erklärt mit seinem Modell des „Tanzes des blinden Reflexes“, warum unser Verhalten oft eine erstaunlich vorhersehbare Reaktion auf unseren „Platz“ im System ist. Er sieht Organisationen als Bühne, auf der wir unbewusst Rollen spielen.
Oshry identifiziert drei grundlegende System-Räume mit typischen Erlebnissen und Reaktionen:
An der Spitze („Tops“): Überlastet und allein

Führungskräfte fühlen sich oft für das große Ganze verantwortlich, aber gleichzeitig isoliert und überlastet. Sie sehen Probleme, die andere nicht sehen, und spüren den Druck des Marktes. Ihr blinder Reflex aus dieser Überlastung: Sie übernehmen die Kontrolle, zentralisieren Entscheidungen und versuchen, alles selbst zu steuern. Damit machen sie die anderen unbewusst passiv und bestätigen ihr eigenes Gefühl, alles allein machen zu müssen.
An der Basis („Bottoms“): Ignoriert und entmachtet

Mitarbeiter ohne formale Führungsrolle fühlen sich häufig ignoriert, entmachtet und von „denen da oben“ missverstanden. Sie erleben Entscheidungen als willkürlich und wenig nachvollziehbar. Ihr blinder Reflex: Sie ziehen sich in den passiven Widerstand zurück, beklagen sich beim Kaffee über die Unfähigkeit des Managements und warten darauf, dass die Probleme von oben gelöst werden. Sie werden zu Opfern des Systems.
Dazwischen („Middles“): Zerrissen und zerquetscht

Das mittlere Management fühlt sich permanent zerrissen und zerquetscht zwischen den strategischen Anforderungen von oben und den operativen Bedürfnissen von unten. Sie sind die Pufferzone. Ihr blinder Reflex: Sie versuchen, es allen recht zu machen, vermitteln, beschwichtigen und verlieren dabei zunehmend ihre eigene Wirksamkeit und strategische Ausrichtung. Sie werden zum Spielball der beiden anderen Pole.

Das Fatale an diesem Tanz: Er hält sich selbst am Leben. Die Spitze kontrolliert, weil sie die Basis als passiv erlebt. Die Basis wird immer passiver, weil die Spitze alles kontrolliert. Und die Mitte reibt sich dazwischen auf. Der Ausweg liegt darin, diesen Tanz zu unterbrechen. Es geht darum, den eigenen positionalen Tunnelblick zu verlassen und echte Empathie für die Realität der anderen „Räume“ zu entwickeln. Das Ziel ist der bewusste Wechsel vom blinden Reflex zur echten Partnerschaft, in der alle gemeinsam Verantwortung für das Gesamtsystem übernehmen.
Die Tiefenstruktur: Das unsichtbare Fundament des Scheiterns
Wir wissen nun, wie Dysfunktionen aussehen und wie sie sich anfühlen. Aber warum sind diese Muster so unglaublich hartnäckig und resistent gegen Veränderung? Dafür müssen wir zur unsichtbaren Architektur unseres Verhaltens vordringen, zum Betriebssystem unserer Organisation.
A) Die kühle Logik des Systems (nach Niklas Luhmann)
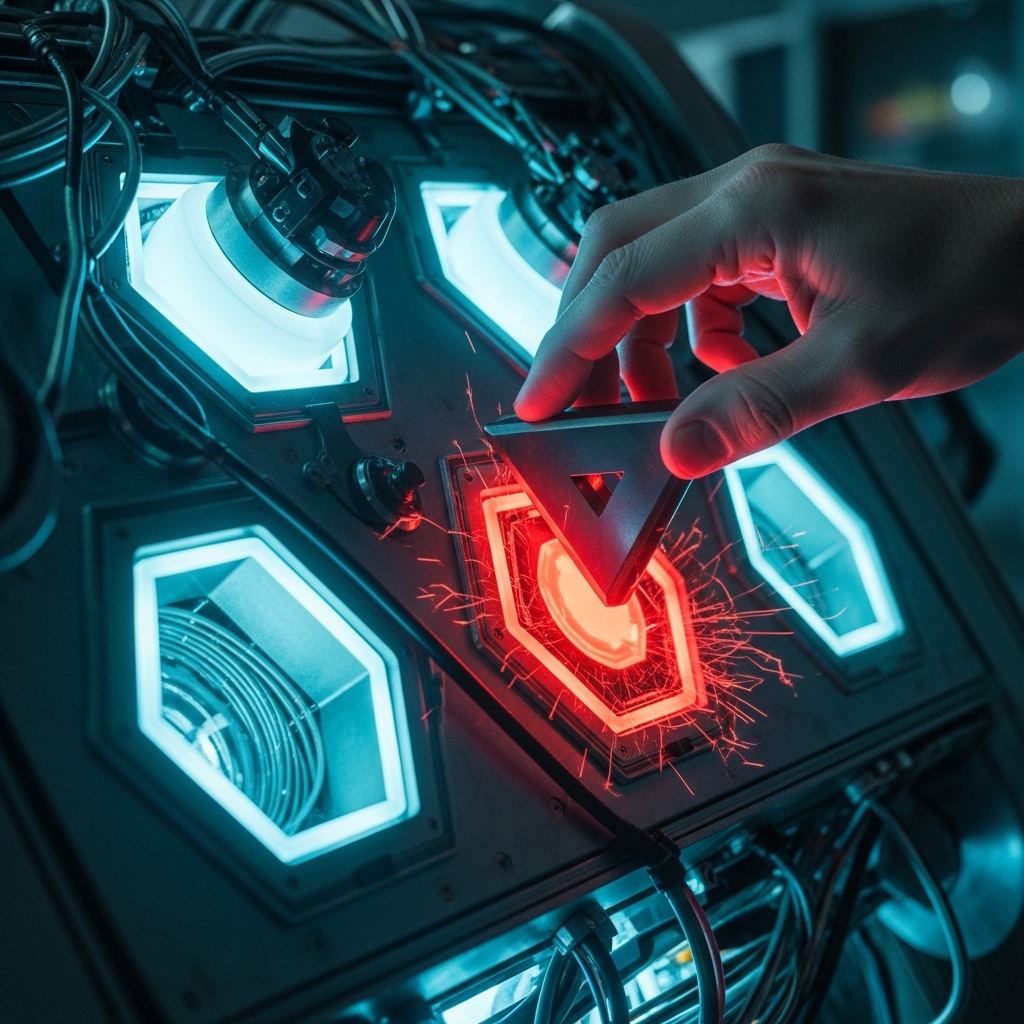
Die Systemtheorie von Niklas Luhmann bietet eine radikale, aber extrem hilfreiche Perspektive: Eine Organisation besteht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation – also aus Entscheidungen, E-Mails, Regeln, Protokollen und Prozessen. Menschen sind die notwendige Umwelt des Systems, aber nicht das System selbst. Das System „benutzt“ uns, indem es uns Rollen anbietet, die wir ausfüllen. Ob eine neue Idee überlebt, hängt nicht von ihrer Genialität ab, sondern allein davon, ob sie an die bisherige Kommunikation „anschlussfähig“ ist.
Stellen Sie sich die Organisation wie ein Computerprogramm vor, das nach seinem eigenen, über Jahre gewachsenen Code läuft. Es ist ihm völlig egal, wer an der Tastatur sitzt. Es akzeptiert nur Befehle, die zu seinem Code passen.
Der „faule“ Herr Meier ist aus dieser Sicht nicht das Problem. Das Problem ist, dass das System ihm eine Rolle anbietet, in der sein Verhalten eine logische, anschlussfähige und für das System erwartbare Reaktion ist.
B) Das verinnerlichte Spiel um Macht und Status (nach Pierre Bourdieu)

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu ergänzt Luhmanns kühle Logik um den gelebten, menschlichen Machtkampf. Organisationen sind für ihn „soziale Felder“ – Arenen mit eigenen, ungeschriebenen Spielregeln und einer eigenen Währung. Diese Währung ist nicht nur Geld, sondern auch soziales Kapital (Netzwerk, wichtige Kontakte), kulturelles Kapital (das richtige Wissen, der richtige Jargon, das richtige Auftreten) und symbolisches Kapital (Status, Prestige, anerkannte Titel).
Der Clou ist der Habitus: Wir verinnerlichen diese ungeschriebenen Spielregeln so tief, dass wir sie unbewusst reproduzieren. Wir entwickeln ein „Gefühl für das Spiel“. Deshalb halten sich Machtverhältnisse oft ganz von selbst stabil – der „Silberrücken“ wird als informeller Anführer akzeptiert, weil er über das im Feld anerkannte Kapital verfügt, nicht weil er formal dazu ernannt wurde.

Wenn wir diese beiden Ebenen verstehen, wird klar, warum Appelle an die Vernunft oder Motivationsseminare so oft scheitern. Sie waren entweder nicht zum Code des Systems „anschlussfähig“ (Luhmann) oder sie haben die realen Machtverhältnisse und ungeschriebenen Spielregeln komplett ignoriert (Bourdieu).
Vom Wissen zum Handeln: Ein 3-Schritte-Modell zur Veränderung
Wie können Sie diese tiefen Erkenntnisse nun praktisch nutzen, um Ihr Team oder Ihre Organisation wirklich voranzubringen? Indem Sie die Ebenen gezielt miteinander verbinden, statt nur an der Oberfläche zu kratzen.
Schritt 1: Das Problem anerkennen und benennen

Hören Sie auf, über Einzelpersonen zu klagen. Schaffen Sie eine gemeinsame Sprache, um die Muster zu beschreiben. Benennen Sie die beobachteten Phänomene klar (z. B. „Wir haben informelle Entscheider, aber keine formale Verantwortung“). Nutzen Sie Oshrys Modell, um den „Tanz“ der verschiedenen Positionen zu analysieren. Allein das schafft eine enorme Entlastung und eröffnet einen neuen, lösungsorientierten Dialog.
Schritt 2: Die tieferen Ursachen aufdecken

Fragen Sie nicht „Wer ist schuld?“, sondern „Warum passiert das immer wieder?“.
- Welche Kommunikationsmuster und Regeln (oder deren Fehlen) erzeugen dieses Ergebnis?
- Welche ungeschriebenen Machtregeln gelten hier?
- Wer profitiert vielleicht sogar von der aktuellen Unklarheit?
Diese Analyse ist der entscheidende diagnostische Schritt, bevor Sie zu Lösungen greifen.
Schritt 3: Das System gezielt gestalten

Statt eines weiteren Appells an die Vernunft der Einzelnen, gestalten Sie das System so, dass erwünschtes Verhalten die logische Konsequenz ist. Wirksame Hebel sind:
- Klare Strukturen schaffen: Definieren Sie explizite Entscheidungsrechte und machen Sie Verantwortlichkeiten transparent (z. B. mit dem Prozess der Rollenklärung). Das entmachtet die „Silberrücken“.
- Den „Tanz“ unterbrechen: Führen Sie Workshops durch, in denen die verschiedenen Positionen (Tops, Middles, Bottoms) bewusst die Perspektive der anderen einnehmen, um gemeinsam neue Verhaltensweisen für eine echte Partnerschaft zu entwickeln.
- Entscheidungsprozesse anpassen: Führen Sie akzeptierte Entscheidungsprozesse ein (z.B. Konsent statt Konsens) und implementieren Sie ein öffentliches Entscheidungs-Logbuch, um Kommunikation nachvollziehbar zu machen. Das schafft Transparenz und Verbindlichkeit.
- Macht fair verteilen: Etablieren Sie Methoden (z. B. Liberating Structures, rotierende Moderation etc.), die gute Ideen vom Status der vorschlagenden Person entkoppeln.
Fazit

Die Frage ist nicht, ob System oder Persönlichkeit stärker ist. Die Antwort ist viel klarer: Das System formt, kanalisiert und belohnt das Verhalten der Persönlichkeit. Die besten, talentiertesten und motiviertesten Menschen werden in dysfunktionalen Strukturen zermürbt, frustriert und zur Mittelmäßigkeit gezwungen. Gleichzeitig können durchschnittlich begabte Leute in exzellent gestalteten Systemen über sich hinauswachsen und gemeinsam Großes leisten.
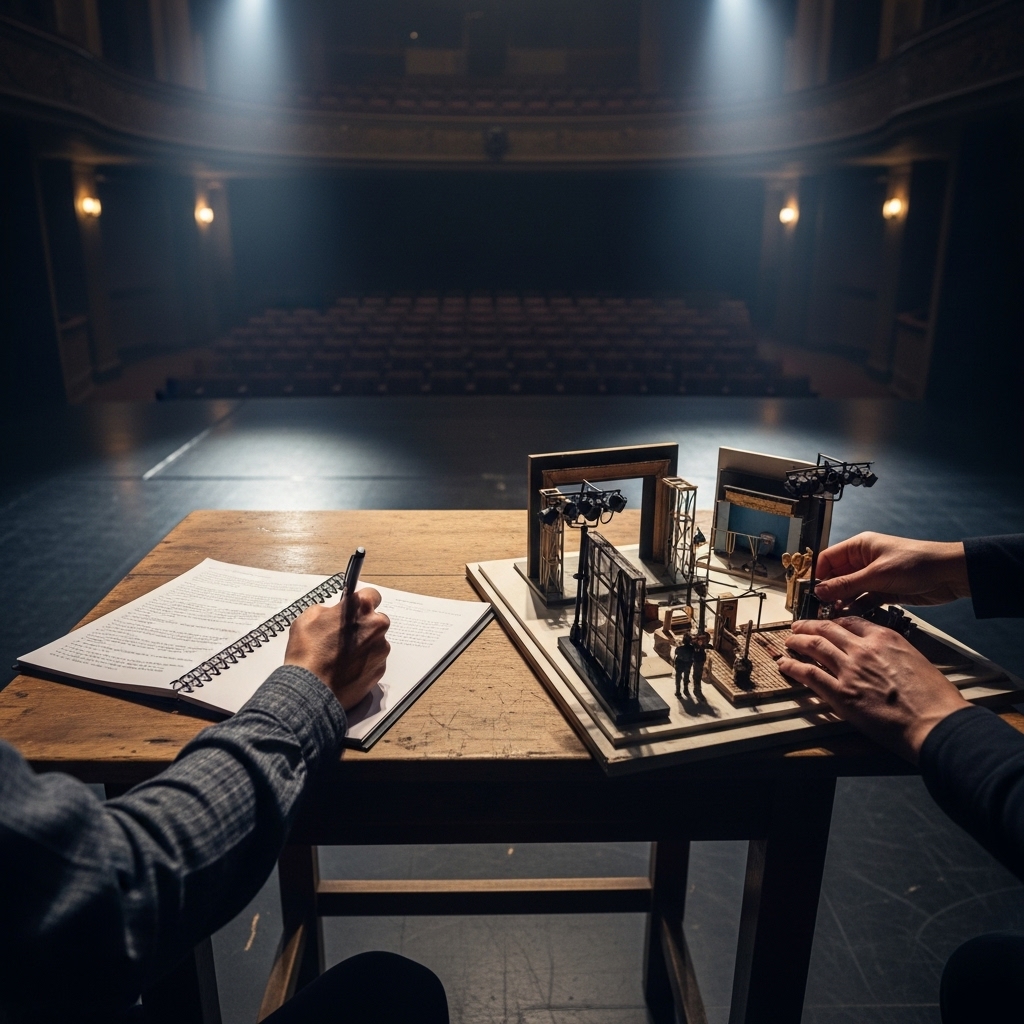
Wirkliche Führung und nachhaltige Veränderung entstehen nicht, indem man versucht, die Schauspieler auszutauschen oder ihnen bessere Laune zu machen. Sie entstehen, indem man das Drehbuch versteht, die Bühne analysiert und beides gemeinsam mit dem Ensemble neu gestaltet. Hören Sie auf, an Menschen zu reparieren. Fangen Sie an, Ihre Systeme zu gestalten.
Quellen und weiterführende Literatur
- Bourdieu, Pierre (1979). Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Suhrkamp Verlag (deutsche Ausgabe 1982).
- Kühl, Stefan (2015). Wenn die Affen den Zoo regieren: Die Tücken der flachen Hierarchien. Campus Verlag.
- Luhmann, Niklas (1984). Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp Verlag.
- Oshry, Barry (2007). Seeing Systems: Unlocking the Mysteries of Organizational Life. Berrett-Koehler Publishers.
